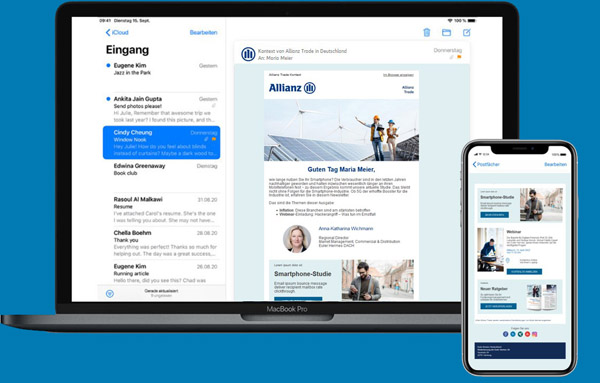Investitionsanreize und Körperschaftssteuer: zwei starke Signale mit einigen Mängeln. An der Steuerfront gibt es gute Nachrichten für deutsche Unternehmen. Zwei wichtige Maßnahmen stechen hervor: Erstens ein Investitionsanreiz, der eine 30-prozentige Sonderabschreibung auf Ausrüstungskäufe zwischen 2026 und 2028 bietet. Dieser vorübergehende Impuls, der etwa 7 Mrd. EUR pro Jahr kostet, könnte die Investitionen um +0,6 % pro Jahr erhöhen und das BIP um +0,1 Prozentpunkte pro Jahr steigern. Obwohl es sich nicht um eine strukturelle Veränderung handelt, werden frühere und größere Investitionen gefördert, wobei die Unternehmen die Entlastung durch höhere zukünftige Steuereinnahmen effektiv zurückzahlen. Zweitens wird die Körperschaftssteuer ab 2028 schrittweise über fünf Jahre um 1 Prozentpunkt pro Jahr von derzeit 29,9 % (2023) gesenkt. Mit geschätzten jährlichen Steuerkosten von 4 Mrd. EUR hält diese schrittweise Senkung die Kosten überschaubar und sendet ein starkes Signal – auch wenn Deutschland erst 2032 ein weltweit wettbewerbsfähiges Steuerniveau erreichen wird. Ein Nachteil ist die dauerhafte Verlängerung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7 % für Restaurants, eine wirtschaftlich ungerechtfertigte Subvention in Höhe von 4 Mrd. EUR pro Jahr.
Einkommensteuer: Abgesehen von einigen Vereinfachungen eine verpasste Gelegenheit. Von einer umfassenden Einkommensteuerreform ist nicht mehr viel übrig. Der Plan, mittelfristig umfassendere Änderungen einzuführen, ist vage und wenig ambitioniert, ohne klare Zahlen. Gezielte Maßnahmen wie die Erhöhung der Steuerfreibeträge für Rentner, Alleinerziehende, Freiwillige und Pendler sowie steuerfreie Überstunden werden jedoch zu einer jährlichen Entlastung von etwa 7 Mrd. EUR führen. Ein Highlight ist die neue Arbeitstagspauschale. Diese wird jedoch größtenteils die Pendlerpauschale ersetzen, die stattdessen auf 38 Cent pro Kilometer angehoben wird – was zusätzliche 2,3 Milliarden Euro pro Jahr bedeutet. Bei den Arbeitszeitanreizen ergibt sich ein gemischtes Bild: Steuerfreies Einkommen für Arbeit nach dem Renteneintritt ist sinnvoll, aber die Freistellung von Überstundenzuschlägen wird sich wahrscheinlich nicht wesentlich auf die Arbeitszeiten auswirken. Zusammen mit kostspieligen Zugeständnissen wie der Senkung der Mehrwertsteuer für Restaurants und der Verlängerung der Pendlerpauschale bleibt wenig finanzieller Spielraum für eine sinnvolle Steuerreform. Unterdessen zeichnen sich kostspielige Rentenmaßnahmen ab, die den Haushalt weiter belasten werden.
Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten bringen eine gewisse Entlastung. Deutsche Unternehmen haben lange mit Stromkosten zu kämpfen, die mehr als 10 Cent pro kWh über dem EU-Durchschnitt liegen, was die Wettbewerbsfähigkeit untergräbt. Die neue Koalition plant, diese Belastung zu verringern, indem sie die Differenz – etwa 5 Cent pro kWh – durch eine Senkung der Stromsteuer und eine Deckelung der Netzentgelte halbiert. Auch die subventionierten Industriestrompreise für energieintensive Unternehmen werden beibehalten. Diese breit angelegten Maßnahmen sind zwar nicht wirtschaftlich präzise, senden aber ein unterstützendes Signal an die Industrie. Zusammengenommen versprechen diese Maßnahmen eine jährliche Entlastung von 11 Milliarden Euro, die durch die CO2-Abgabe finanziert werden. Um jedoch eine dauerhafte Verbesserung zu erreichen, muss das Problem des Mangels an zuverlässiger Grundlastenergie in Deutschland angegangen werden. Zu diesem Zweck plant die Regierung, bis 2030 Anreize für bis zu 20 GW neue Gaskraftwerkskapazität zu schaffen, was die nationale Stromerzeugung um etwa +6 % gegenüber dem aktuellen Verbrauch steigern könnte. Die Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken steht jedoch nicht auf der Tagesordnung.
Bürokratieabbau: vielversprechende Schritte, aber viele offene Fragen. Die neue deutsche Regierung hat ein "Sofortprogramm" zum Abbau von Bürokratie angekündigt, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), das bis Ende 2025 umgesetzt werden soll. Die Bürokratiekosten belaufen sich auf 146 Milliarden Euro pro Jahr, wobei die direkten Kosten auf 65 Milliarden Euro geschätzt werden (Abbildung 2). Das Leitprinzip besteht darin, von Kontrolle und Regulierung zu Vertrauen überzugehen. Zu den geplanten Maßnahmen gehören die Reduzierung der Anzahl der obligatorischen Unternehmensvertreter, die Lockerung der Schulungs- und Dokumentationsanforderungen und die Vereinfachung der Compliance-Auflagen. Die Koalition unterstützt auch die EU-Omnibus-Richtlinie zur Nachhaltigkeit, einschließlich der CSDDD, CSRD, Taxonomie und CBAM – besteht jedoch auf einer "unbürokratischen" Umsetzung, insbesondere für KMU. Auf nationaler Ebene soll das deutsche Lieferkettengesetz aufgehoben und durch die CSDDD der EU ersetzt werden, wobei abzuwarten bleibt, ob dies wirklich weniger Bürokratie bedeutet. In Kombination mit anderen Deregulierungsbemühungen, wie der Aufhebung des Heizungsgesetzes, strebt die Regierung eine Reduzierung der Bürokratie um 25 % über einen Zeitraum von vier Jahren an, was eine geschätzte Entlastung der Wirtschaft in Höhe von 16 Mrd. EUR bedeuten würde. Zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung wird eine digitale One-Stop-Plattform für Bürger und Unternehmen eingeführt, die die Gründung von Unternehmen innerhalb von 24 Stunden ermöglicht. Bis 2029 soll das Personal in Ministerien und Bundesbehörden um 8 % reduziert werden, nachdem es in den letzten zehn Jahren um mehr als 30 % aufgestockt wurde, wodurch potenziell 2 Mrd. EUR pro Jahr eingespart werden könnten. Ein neues Ministerium für digitale Angelegenheiten wird diese "standardmäßige Digitalisierung" leiten.
Auch die Genehmigung von Infrastrukturvorhaben soll durch ein neues Gesetz beschleunigt werden, das einen schnelleren Zugang zum 500 Milliarden Euro schweren Infrastrukturfonds für Projekte wie Straßen, Schienen und Schulen ermöglicht. Diese Projekte werden als von "übergeordnetem öffentlichem Interesse" eingestuft, um rechtliche Anfechtungen zu reduzieren. Um die Genehmigungen für Infrastrukturprojekte wirklich zu beschleunigen und die 500 Milliarden Euro des Sonderinfrastrukturfonds tatsächlich nutzen zu können, die letztendlich hauptsächlich für Straßen, Brücken, Schienen und Schulen ausgegeben werden sollen, beabsichtigt die neue Bundesregierung, die Planungs- und Genehmigungsverfahren im Rahmen eines künftigen Infrastrukturgesetzes zu beschleunigen. Diese Projekte sollen im "übergeordneten öffentlichen Interesse" liegen, was Rechtsstreitigkeiten verkürzt. Ob die übermäßigen Beteiligungs- und Klagerechte von Umweltverbänden am Ende tatsächlich eingeschränkt werden, ist aber nicht klar. Im Koalitionsvertrag findet sich dazu kein ausdrückliches Bekenntnis.